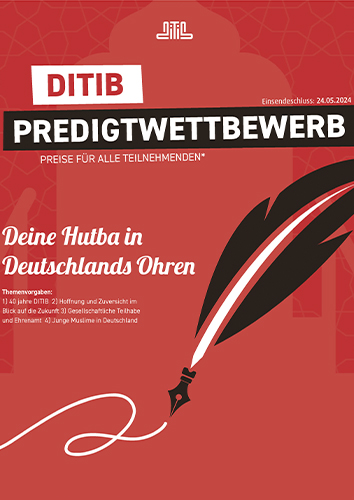2024-06-12 | Pressemeldung
Gemeinsam unterwegs für Vielfalt - Gegen antimuslimischen Rassismus und Antisemitismus
Die Türkisch-Islamische Union (DITIB) hat das Projekt „Gemeinsam unterwegs für Vielfalt“ gegen antimuslimischen Rassismus und Antisemitismus mit einer Fachtagung am 05.05.2024 gestartet. Das Projekt richtet sich an die 22 Religionsbeauftragten der DITIB, die vor kurzem ihre Ausbildung in Dahlem beendet haben und den aktiven Dienst in den DITIB-Gemeinden übernehmen. Nach der Fachtagung haben sie Auschwitz und Srebrenica besucht.
Ziel des Projektes „Gemeinsam unterwegs für Vielfalt - Gegen Antisemitismus und antimuslimischen Rassismus“ ist es, Informationen, Impulse und Argumente an die Religionsbeauftragten der DITIB zu vermitteln. Damit können sie sich in ihren Gemeinden aktiv gegen Antisemitismus und antimuslimischen Rassismus einsetzen.
Das Projekt vermittelt den Religionsbeauftragten Wissen und Erkenntnis, um mit diesem Handwerkzeug die Thematiken Respekt, Empathie, Reflexion und Perspektivwechsel sowie Verständnis für das Gegenüber, deren Ängste etc. in die eigene Gemeindearbeit hineinzutragen, damit demokratische Werte in der Gesellschaft aktiv gelebt und sichtbarer werden.
Nachhaltige Ziele der Projektträger sind ferner:
- Sensibilisierung durch Wissensvermittlung in Bezug auf Antisemitismus und antimuslimischen Rassismus
- Prävention gegen Radikalisierung und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit
- Austausch mit Institutionen, Einrichtungen und Gemeinden
- Bildung von Netzwerken gegen Radikalisierung und Extremismus
- Förderung der Vielfalt für ein stärkeres Wir-Gefühl
- Stärkung demokratischer Werte
An dem einleitenden Fachtag haben verschiedene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu den Ursachen und Auslösern von Antisemitismus und antimuslimischen Rassismus referiert.

Dr. Muharrem Kuzey, Vorstandvorsitzender des DITIB-Bundesverbandes hob die Bedeutung dieses Projektes und der Begegnung hervor: „Und wenn gleichzeitig die Erfahrungswelt immer ärmer wird, Begegnungen abnehmen und Rückzug in die eigene Wohlfühlzone zunimmt, dann haben Agitatoren, Hetze und Hass ein einfaches Spiel. Deshalb ist dieses Projekt wichtig. Es bringt uns in unserer Vielfalt zusammen, aber auch in unserem Mitgefühl.“

Frau Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, Antisemitismusbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen, wandte sich in ihrem Grußwort digital an die Teilnehmer und hob darin die Bedeutung der Begegnung und des Gespräches zwischen verschieden religiösen Gruppen hervor. Bezüglich des steigenden Extremismus betonte sie: ‚Das führt zu Angriffen, Beschimpfungen, Beleidigungen und das führt zu Gewalt. Dagegen müssen wir gemeinsam aufstehen, gemeinsam als Demokratinnen und Demokraten in unserer Zivilgesellschaft, weil wir die Würde der Menschen verteidigen. Denn sie wird angegriffen durch Antisemitismus, Islamophobie und antimuslimischen Rassismus. Und das ist der wichtigste Wert für unser Zusammenleben, die Achtung und den Respekt dem anderen gegenüber."

Herr Rafi Rothenberg, Vorstandsmitglied der Jüdische Liberale Gemeinde Gescher La Massoret, betonte in seinem Grußwort die Bedeutung dieses Projektes.

Prof. Dr. Michael Kiefer vom Institut für Islamische Theologie der Universität Osnabrück hielt einen Vortrag über Extremismen im sozialen, politischen und gesellschaftlichen Leben. Die Bestandaufnahme über Antisemitismus in der Migrationsgesellschaft verdeutlichte er anhand von Studien deutscher Universitäten.

Prof. Dr. Meltem Kulaçatan von der Universität Erlangen hielt einen Vortrag mit dem Titel „Verschränkungen zwischen antimuslimischem Rassismus und Antisemitismus - Schwerpunkt jugendliche Lebenswelten“. Prof. Kulaçatan ging in ihrem Vortag in die Begrifflichkeiten der Muslimfeindlichkeit (auch: Antimuslimischer Rassismus) und des Antisemitismus ein und bezog für ihre Analyse auch Studienergebnisse ein, worin die Interviewten in Bezug auf Wünsche und Forderungen eine verstärkte Zusammenarbeit innerhalb muslimischen Communities formulierten. „Das selbstverständliche Bekenntnis zur pluralen und internationalen Gesellschaft steht für viele der Interviewten im Vordergrund. Dazu gehört die Kritik an Identitätspolitiken und die Forderung nach einer konstruktiveren Bearbeitung der Zugehörigkeitsfrage: Ab wann sind MigrantInnen keine MigrantInnen mehr? An dieser Stelle müsste darüber hinaus die Diskussion insgesamt deutlich stärker dahingehend geführt werden, weshalb Bindungen im Kontext von vielheitlichen, mehrheimischen und weltheimischen Zugehörigkeiten nach wie vor aversiv begegnet wird.“

Herr Lino Marius Klevesath vom Institut für Demokratieforschung der Georg-August-Universität Göttingen hat über „Antisemitismus unter MuslimInnen. Zur Frage der Quellen des Phänomens“ vorgetragen.

Frau Merve Biber, Mitarbeiterin der DITIB-Antidiskriminierungsstelle (DITIB ADS), hat den Antimuslimische Rassismus am Beispiel der Moscheeübergriffe verdeutlicht: „Seit dem 7.10.2023 haben Übergriffe auf Moscheen drastisch zugenommen. Stand 6. Oktober waren es 43 Fälle, nach dem 7.10 endete das Jahr 2023 mit 137 Übergriffen. Ähnlich wie der 9/11, hatte auch der 7.10 zur Folge, dass Muslime pauschal unter Generalverdacht gerieten, Antisemiten zu sein bzw. mit der Hamas zu sympathisieren. Gemeinsame Gebete für Opfer auf beiden Seiten fanden statt, jedoch konnte man für diese Friedensgebete nur christliche Partner finden. Momentan besteht die Schwierigkeit darin, jüdische Gemeinden zu erreichen und gemeinsam für Frieden und Gerechtigkeit einzutreten. Sich selbst abzuschotten und den Kontakt zueinander abzubrechen, hilft niemandem. Wir brauchen vielmehr Begegnung, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken.“

Prof. Dr. Thomas Lemmen von der Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen ging auf „Dialog und Frieden; Menschen im Dialog gegen antimuslimischen Rassismus und Antisemitismus“ ein und hob darin den Respekt der Menschen unterschiedlicher Religionen als eine Möglichkeit des aktiven Handelns gegen Extremismus und Rassismus hervor.

Die Fachtagung endete mit einer Podiumsdiskussion, die mit den Referenten des Tages besetzt war und von Dr. Altuğ moderiert wurde. Nach diesem einleitenden Modul haben die Religionsbeauftragten im Rahmen des Projektes die Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau in Polen und den Gedenkort Srebrenica in Bosnien besucht.

Es war eine mehrtätige Gedenkstätten-Besuchsreihe sowie der Besuch von Vertretern jüdischer, muslimischer und christlicher Gemeinden angesetzt.


In Gesprächen, Führungen und Workshops wurden Informationen vermittelt. Die Teilnehmenden sollen über Strategien und Methoden nachdenken, wie man mit Argumenten und Handlungen dauerhaft gegen antimuslimischen Rassismus und Antisemitismus in der Gemeindearbeit vorgehen kann.



Im 3. Modul konnten die Religionsbeauftragten den Dialog mit Gemeinden, Institutionen und Einrichtungen aufbauen, um gemeinsame Strategien gegen Radikalisierung und Extremismus zu entwickeln. Damit können sie sich in ihren Gemeinden aktiv gegen Islamophobie und Antisemitismus einsetzen und gegenseitige Empathie, Solidarität und Zusammenarbeit in der Gesellschaft stärken.


Das Projekt richtet sich an die Absolventen der Ausbildung zur/zum Religionsbeauftragten der DITIB. Die dauerhafte Fortsetzung des Projektes ist für die kommenden Lehrgänge der Ausbildung zur/zum Religionsbeauftragten geplant. [PDF PROGRAMMHEFT]